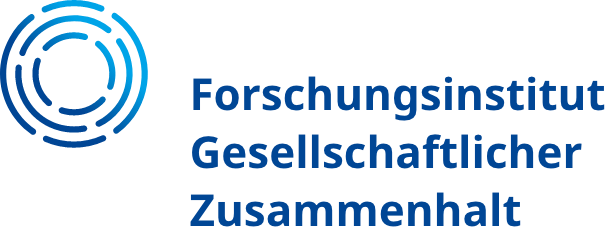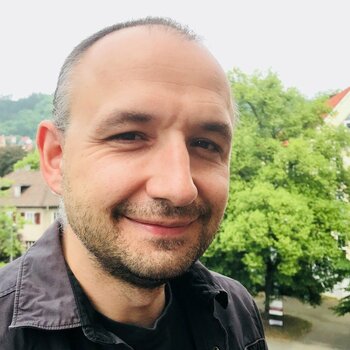Das Arbeitspaket untersucht, wie sich gesellschaftliche Konflikte in sozialen Medien polarisieren und wie diese Dynamik politisch instrumentalisiert wird. Der Fokus liegt auf den Strategien von sogenannten ‚Polarisierungsunternehmer:innen‘ und den Folgen für den demokratischen Zusammenhalt. Gleichzeitig wird erforscht, wie soziale Medien produktiv genutzt werden können, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken.
Soziale Medien haben die Art, wie wir als Gesellschaft miteinander kommunizieren verändert. Sie beeinflussen auch grundlegend, wie wir uns informieren und uns Meinungen bilden. Die Folgen dieser Transformation sind zwiespältig und werden kontrovers diskutiert.
Einerseits erleichtern soziale Medien die demokratische Partizipation. Andererseits tragen sie aber auch zur Polarisierung gesellschaftlicher Debatten bei und bieten Demokratiefeinden Möglichkeiten zur Mobilisierung.
Das Arbeitspaket untersucht, wie solche Polarisierungsdynamiken in den sozialen Medien entstehen und verlaufen. Es betrachtet auch ihre Auswirkungen auf andere Bereiche der Gesellschaft. Der Schwerpunkt liegt dabei auf folgender Frage: Wie nutzen demokratiefeindliche ‚Polarisierungsunternehmer:innen‘ soziale Medien? Damit sind Akteure gemeint, die gesellschaftliche Konfliktthemen aufgreifen und befeuern. Sie mobilisieren für ihre politische Agenda. Uns interessiert, welche Folgen dies für den demokratischen Zusammenhalt on- und offline hat.
Das Arbeitspaket ist Teil des Themenfelds A Politik des demokratischen Zusammenhalts. Vor diesem Hintergrund interessiert uns besonders der Beitrag polarisierter digitaler Diskurse zur Krise der demokratischen Repräsentation. Konkret untersuchen wir, wie soziale Medien genutzt werden, um gesellschaftliche Identitätskonflikte zu vertiefen und politisch zu instrumentalisieren.
Umgekehrt wollen wir so aber auch mehr darüber erfahren, wie sich das produktive Potential sozialer Medien nutzen lässt. Wie lassen sich verschiedene Teile der Gesellschaft ermutigen, sich mittels sozialer Medien für den demokratischen Zusammenhalt einzusetzen?
Transferaktivitäten
Unsere Forschung dient nicht nur dem wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse. Mit vielfältigen Transferaktivitäten zum Verhältnis von Zusammenhalt und sozialen Medien suchen wir auch den Austausch mit der interessierten Öffentlichkeit.
Inhalte des Arbeitspakets
Das Arbeitspaket (AP) untersucht aktuelle Politisierungs-und Polarisierungsdynamiken in den sozialen Medien, deren Entstehung und Auswirkungen. Wir gehen dabei von der Beobachtung aus, dass insbesondere digitale Medien als Möglichkeitsraum für politisch extreme Akteure fungieren und durch ihre Aufmerksamkeitsökonomie die Zunahme von emotional-affektiver und konfliktorientierter Sprache fördern. Im Hinblick auf das Verhältnis digitaler, radikalisierter fringe communities zur öffentlichen Diskurssphäre und zur analogen Umwelt, überprüfen wir die Annahme, dass es sich hierbei nicht um voneinander unabhängige Phänomene handelt. Stattdessen, so die zu überprüfende These, bestehen teils enge, wechselseitige Interaktionen zwischen diesen Sphären, die von digitalen „Polarisierungsunternehmern“ strategisch genutzt werden und gesellschaftliche Polarisierungsdynamiken auch jenseits „digitaler fringe communities” befördern können. Das AP adressiert damit beide Leitfragen des Schwerpunkts 4 „Politisierung von Differenz“. Es untersucht einerseits, wie verschiedene Themen durch die Online-Kommunikation radikalisierter Gruppen auch offline an Salienz gewinnen und zunehmend kontestiert werden und andererseits, wie diese Dynamiken zu (wahrgenommenen) Spaltungstendenzen in der Gesellschaft beitragen und den demokratischen Prozess beeinflussen.
Nach anfänglicher Euphorie über die demokratischen Potenziale des Internets sind seit spätestens Mitte der 2010er-Jahre die sozialen Medien immer stärker mit Gefährdungen des demokratischen Zusammenhalts assoziiert worden. Die Zunahme von konfliktgeprägter Kommunikation, die Verbreitung von Desinformationen und die erhöhte Sichtbarkeit von randständigen Stimmen, die zum Teil äußerst konfrontative Positionen und Diskurspraktiken vertreten, lassen sich nicht eindeutig einem politischen Lager zuordnen. Allerdings scheinen insbesondere antidemokratische, radikal rechte, antisemitische und verschwörungsideologische Akteur:innen, die von der Krisenhaftigkeit der Gegenwart profitieren, die digitalen Medien als zentralen Aktionsraum erfolgreich zu nutzen. Ob Migrationspolitik, Corona-Pandemie, Ukrainekrieg oder Klimathematik – die digitalen Mobilisierungsstrategien von Antidemokrat:innen werden ausgebaut und sind von überlappenden Akteurs-und Themenkonstellationen geprägt.
Insbesondere über Social-Media-Plattformen wie Telegram, Messenger-Dienste und alternative Nachrichtenseiten haben sich Netzwerke etabliert, die erfolgreich zur Ideologieproduktion und -dissemination sowie zur Mobilisierung von Offline-Protesten eingesetzt werden. Die Aufmerksamkeitsökonomie des Internets und die Empörungskultur auf Social-Media-Plattformen scheinen diese Dynamiken zu begünstigen. Gezielte Kampagnen gegen marginalisierte Gruppen, Personen und Institutionen der demokratischen Ordnung verdeutlichen die Vernetzung, Radikalisierung und Normalisierung radikal rechter, verschwörungsideologischer Akteure und Inhalte. Verschwörungserzählungen, Desinformationen und wissenschaftsfeindliche Narrative werden Teil von Krisendiskursen, die Handlungsspielräume demokratischer Institutionen einengen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt untergraben. All dies kann systematische, themenübergreifende Einstellungskonflikte und die wechselseitige Abschottung gegensätzlicher Lager in der gesamten Gesellschaft befördern. Thematisch-inhaltlich bestehen damit enge Verbindungen zu den anderen AP des Schwerpunkts, die Politisierungsdynamiken von Geschlechterfragen (A_09) und Kriegsbeteiligung (A_10) und ihre Folgen für den demokratischen Prozess untersuchen. Im Unterschied dazu ist dieses AP allerdings nicht auf eines dieser Themen fixiert, sondern richtet seinen Blick allgemein auf die spezifischen Mechanismen und Funktionsweisen digitaler Kommunikation. Durch eine Synthese der unterschiedlichen Zugänge der genannten AP soll das Verhältnis von On- zu OfflineProtestmobilisierungsdynamiken eruiert und der Vergleich zwischen unterschiedlichen Politisierungsthemen ermöglicht werden. In diesem AP bauen wir ein plattformübergreifendes Monitoring-System auf, um Diskurspraktiken, Akteursgruppen und Interaktionsmuster zu untersuchen, die mit Polarisierungs- und Fragmentierungsprozessen in Verbindung stehen. Durch diese Infrastruktur soll es ermöglicht werden, die folgenden Fragen zu bearbeiten: Welche Zusammenhänge zwischen On- und Offlinedynamiken existieren? Welche räumlichen Muster radikal rechter und verschwörungsideologischer Online-Mobilisierung bestehen und wo und unter welchen Umständen sind sie besonders erfolgreich? Welche aktuell aufkommenden Ereignisse und Themen werden aufgegriffen? Welche Rolle spielen digitale Plattformen für die Zunahme von emotionalisierter und konfliktorientierter Sprache im digitalen Raum? Inwiefern beeinflussen die aufgezeigten fringe communities den öffentlichen Diskurs? Und: Welche Möglichkeiten eröffnen sich für aussichtsreiche Konzepte einer digitalen demokratischen Gegenöffentlichkeit?