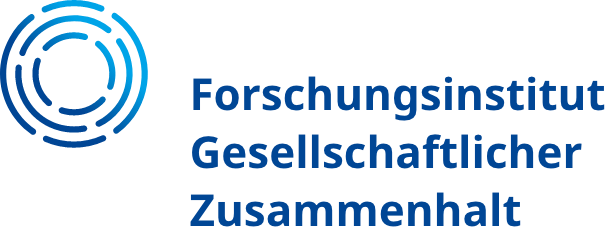Die Corona-Pandemie hat nicht nur Versorgungslücken, sondern auch soziale Faktoren von Gesundheit gesellschaftlich sichtbar gemacht. Wir untersuchen gesundheitspolitische Initiativen und ihre historischen Vorläufer. Diese Initiativen stellen Versorgung bereit, wo öffentliche Infrastrukturen im Gesundheitsbereich an Grenzen stoßen.
Das kulturhistorische Arbeitspaket (AP) untersucht Praktiken und Vorstellungen von gesellschaftlichem Zusammenhalt im Bereich der gesellschaftlichen Reproduktion. Wer ist vulnerabel, wer kann sich schützen, wer hat Zugang zu Wissen und Versorgung?
Diese Fragen prägen seit den 1970er Jahren gesellschaftliche Konflikte um Gesundheitspolitik. Sie brachten in Deutschland wie Italien zivilgesellschaftliche und aktivistische Initiativen hervor, die Gesundheit als Hebel für politische Veränderung begriffen. Ihre praktischen Ansätze werden gegenwärtig zumeist auf lokaler Ebene aufgegriffen. Dies geschieht in Stadtteilgesundheitszentren, Gesundheitsgenossenschaften oder Kampagnen. Diese klagen Gesundheitsversorgung als unteilbares soziales Recht ein. An ihnen lassen sich die Spielräume für Gestaltungen öffentlicher Güter und Infrastrukturen aufzeigen. Zudem kann man hier ihr transformatives Potential für Zusammenhalt verstehen. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die kommunale Ebene.
In mehreren historisch vergleichenden Fallstudien untersucht das Arbeitspaket, wie im Feld sozialer Reproduktion alternative Formen von Zusammenhalt erprobt werden. Die empirische Forschung beruht auf umfassenden Archiv-Recherchen, der Auswertung von Zeitschriften und Flugblättern. Sie bezieht ebenso die Entwicklung (feministischer) Theorien sozialer Reproduktion mit ein. Feldforschungen bieten Einblicke in die Arbeitsbereiche und Organisationsstrukturen nicht-institutioneller Akteur:innen. In Leitfaden-Interviews legen diese ihr gesellschaftliches Selbstverständnis zwischen Wohlfahrtsstaat und Ehrenamt dar.
Transferaktivitäten
Workshops fördern einen langfristigen Austausch zwischen Wissenschaft, Praxis und Gesellschaft. Dies stärkt das Verständnis für die Rolle des Care-Sektors im Gemeinwohl. Eine interaktive, digitale Recherchelandkarte macht nicht-institutionelle Akteur:innen sichtbar. Sie hebt ihre bislang unterbewertete Fürsorgearbeit im Gesundheitsbereich hervor.
Inhalte des Arbeitspakets
Angesichts der Erfahrungen mit der Corona-Pandemie und dem Sichtbarwerden eklatanter Lücken in Gesundheitsversorgung und im Pflegebereich ist gegenwärtig eine Krise der sozialen Reproduktion auszumachen. Vor allem im Bereich der staatlich organisierten Fürsorgebeziehungen kommen öffentliche Infrastrukturen vielfach an ihre Grenzen. Das im zweiten Schwerpunkt verortete Arbeitspaket (AP) trägt mit einer historisch-genealogischen Perspektive auf selbstorganisierte und aktivistische Gesundheitsinitiativen zu einem Verständnis von Infrastrukturen der Daseinsvorsorge als Orte der Gestaltung, Transformation und alternativer Vorstellungen von Zusammenhalt bei. Damit adressiert es die themenspezifischen Fragen, inwiefern Infrastrukturen der Gesundheitsversorgung als trennend oder bindend wahrgenommen werden und wie sich das Verhältnis von öffentlicher Verantwortung und zivilgesellschaftlicher Initiative bei der Erstellung öffentlicher Güter gestaltet. Ausgehend von mehreren historischen Fallstudien soll darüber hinaus auf konzeptionell-theoretischer Ebene erarbeitet werden, welche Spezifik das Feld sozialer Reproduktion historisch und gegenwärtig zum einen als Gegenstand und Spiegel gesellschaftlicher Konflikte um Infrastrukturen zwischen voice und exit und zum anderen als Ort der Neuverhandlung von Zusammenhalt aufweist.
Seit einigen Jahren ist eine Repolitisierung von Care-Arbeit vor allem im Gesundheitsbereich, mit ihrem stärksten institutionalisierten Ausdruck in Pflege-Streiks zu verzeichnen. Aber auch auf der nicht-institutionalisierten, zumeist lokalen Ebene lassen sich praktische Ansätze ausmachen, in denen sich Aushandlungen und Gestaltungen öffentlicher Güter und Infrastrukturen im Gesundheitsbereich zeigen, etwa die Entstehung von Stadtteilgesundheitszentren u.a. in Berlin und Freiburg; die Gründung von Gesundheitsgenossenschaften oder Kampagnen, wie die MediNetze oder Clearingstellen, die Gesundheitsversorgung als unteilbares soziales Recht einklagen und verwirklichen. Vergleichend soll ein Netzwerk von Initiativen rund um das Centro di Salute Internazionale e Interculturale in Bologna und die italienische Sektion des International People’s Health Movement, das gesundheitspolitische Recherchekollektiv Gruppa herangezogen werden, um unterschiedliche Entstehungsbedingungen aktivistischer Gesundheitspolitiken und ihr transformatives Potential für die kommunale Ebene zu verstehen. Bologna kann als Modellstadt hinsichtlich der Verbindung aktivistischer und zivilgesellschaftlicher Initiativen mit kommunalen Infrastrukturen bei der Bereitstellung einer inklusiven Gesundheitsversorgung gelten. Es stellt sich im Sinne Hirschmans die Frage nach der Artikulation von voice als Schwellenphänomen, das sich in neuen und gleichzeitig immer wieder erneuerbaren Formen der Organisierung verwirklicht, die bestenfalls verallgemeinerbar sind.
Die Orientierung heutiger Initiativen an sozialen Determinanten von Gesundheit ist nicht neu, sie knüpfen sowohl in Deutschland als auch in Italien an gesellschaftskritische Perspektiven der Gesundheitsbewegung seit den späten 1970er Jahren an. Gegenwärtig werden diese vor dem Hintergrund zunehmender Kommodifizierung und Ungleichheit erneut für relevant erachtet.
Historische wie gegenwärtige Initiativen bilden das empirische Zentrum des APs. In Deutschland versammelten sich im Nachgang der Studierendenbewegung und etwas später im Kontext der Frauen- und Hausbesetzer:innenbewegung in Berlin, Frankfurt am Main oder Heidelberg Gruppen, die Gesundheitspolitik herrschaftskritisch und partizipativ verändern wollten und sich z.T. auch auf lokaler Ebene etablieren konnten. Schon damals war Italien und die dortige Gesundheitsreform im Jahr 1978 ein Bezugspunkt, da diese u.a. die Partizipation verschiedener Bevölkerungsgruppen festschrieb und eine liberale Ansätze zu reproduktiver und mentaler Gesundheit enthielt, wie sie u.a. von der anti-psychiatrische Bewegung in Triest erkämpft wurden.
Dabei sind auch Ambivalenzen dieses „Engagements“ im Verhältnis zu Wohlfahrtstaatlichkeit und Ökonomie herauszuarbeiten, die jüngst als „Verzivilgesellschaftlichung“ sozialer Rechte oder auch als „Mutualism“ unter den Bedingungen des flexiblen Kapitalismus beschrieben wurden. Die Perspektive der Fallstudien bleibt dabei gegenwartsbezogen: Welche politischen und (infra-)strukturellen Anknüpfungspunkte bieten historische Vorläufer für heutige Initiativen, eine demokratische inklusive Gesundheitsversorgung zu gewährleisten und wie begreifen diese ihre Arbeit und Gesundheitspolitik im Allgemeinen im Bezug zu Fragen gesellschaftlichen Zusammenhalts?