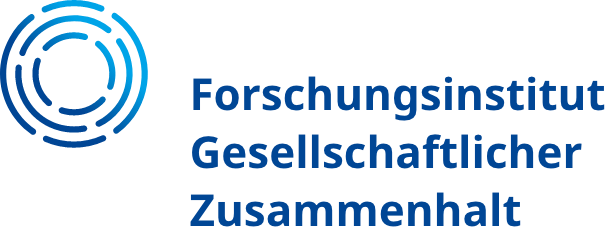Wir leben in einer Gesellschaft, in der nicht alle Menschen die gleichen Chancen haben. Merkmale wie Herkunft, Geschlecht, Bildung, sexuelle Orientierung, Alter oder Sprache beeinflussen unsere gesellschaftliche Stellung und daran geknüpfte Privilegien. Dieses Arbeitspaket untersucht, wie Menschen als „Allies“ ihre Privilegien für eine gerechtere und weltoffenere Gesellschaft einsetzen können, um den demokratischen Zusammenhalt zu stärken.
Der Begriff Allyship ist in den letzten Jahren auch im deutschsprachigen Raum populär geworden. Allyship heißt, Ressourcen und Macht zugunsten von Benachteiligten einzusetzen oder abzugeben. Das Besondere daran ist, dass die Lebensentwürfe und sozialen Verhältnisse von Benachteiligten und ihren Allies teilweise sehr unterschiedlich sind. Und trotzdem verbünden sie sich, um Diskriminierung entgegenzuwirken. Obwohl der Begriff so beliebt ist, wird Allyship unterschiedlich verwendet und verstanden.
Wir wollen herausfinden, was Allyship ausmacht und braucht, um zu gelingen. Dazu werten wir vorhandene Literatur sowie Interviews und Befragungen aus. Besonders wichtig ist uns, die Perspektive von Menschen mit Diskriminierungserfahrungen einzubeziehen. Welche Möglichkeiten der Unterstützung durch Allies gibt es? Was braucht Allyship, um wirklich hilfreich zu sein? Und wann ist die Unterstützung zwar gut gemeint, bringt aber wenig oder verstärkt sogar Ungleichheiten? Im engen Austausch mit der Zivilgesellschaft sollen am Ende konkrete Handlungsempfehlungen formuliert werden.
In Zeiten zunehmender Polarisierung, wo die Berührungspunkte mit Bevölkerungsgruppen jenseits der eigenen sozialen und ideologischen „Blase“ seltener werden, ist Allyship wichtig. Sie ermöglicht Einblicke in andere Lebenswelten und kann so gesellschaftliche Gräben überbrücken. Im Idealfall baut sie Strukturen der Ungleichheit und Vorurteile ab.
Inhalte des Arbeitspakets
Demokratien sind von dauerhaften Aushandlungsprozessen um Deutungsmacht, Normvorstellungen, Identitäten und Partizipation geprägt, die eine Neugestaltung des gemeinschaftlichen Handelns erfordern. Als eine spezifische Praxis ebenjenes Handelns beinhaltet das Arbeitspaket (AP) eine differenzierte Untersuchung des Konzepts „Allyship“, also des Verbündetseins zwischen gesellschaftlichen Teilgruppen. Neben der Frage, wie sich Allyship zu assoziierten Begrifflichkeiten, etwa dem der „Kompliz:innenschaft, „Koalition“ oder „Solidarität“ sowohl in ihrer historischen Rezeption als auch ihrer Wirkweise abgrenzt, steht vor allem die aktuelle gesellschaftspolitische Relevanz von Allyship im Engagement im Fokus. Wie wirkt Allyship hier als Form der Vergemeinschaftung über kategoriale Gräben hinweg hin zu einer gemeinsamen Verstehensbasis mit neuen Identifikationsmöglichkeiten? Welches Potenzial birgt Allyship als Gegenentwurf zu den medial befeuerten „Zerfallserscheinungen“ – also gewissermaßen als Beitrag zu einem demokratischen, inklusiven Zusammenhalt?
Eng verknüpft mit den Anliegen der LGBTIQ- und Black Lives Matter-Bewegungen in den USA gewinnt der Begriff „Allyship“ seit einigen Jahren auch im deutschsprachigen Raum an Popularität. Dabei verbleibt der Begriff in seinen konkreten Anforderungen und Spezifika vage. In der einschlägigen Literatur unterscheiden sich Auslegungen u.a. wesentlich in der Frage von Allyship als Akt oder Identität, als Selbst- bzw. Fremdbezeichnung, den Umgang mit Privilegien betreffend, sowie hinsichtlich ihrer betrachteten Wirkungsebenen. Gerade in dieser Vielseitigkeit (oder Beliebigkeit?) des meist positiv konnotierten Begriffs offenbaren sich jedoch auch Schwächen und Widersprüchlichkeiten. In der jüngeren Literatur werden diese als ally paradox oder als Lippenbekenntnissen und leeren Gesten der performative allyship diskutiert und kritisiert.
Im Sinne des Schwerpunkts untersucht dieses AP vor allem Aushandlungs- und Gruppenprozesse sowie Praktiken von Allyship, die darauf abzielen, hegemoniale Denkmuster zu durchbrechen und Handlungsspielräume in scheinbar festgefahrenen Identitätskonflikten zu eröffnen. Wird Allyship als Partizipationsmöglichkeit verstanden, die auch dem Anspruch der Akzeptanz gesellschaftlicher Vielfalt in der Antidiskriminierungsarbeit gerecht werden soll, darf ein kritischer Blick auf Barrieren, Herausforderungen und Gefahren von Allyship nicht fehlen. Wesentlich dafür ist ein intersektionales Verständnis von gesellschaftlichen Ungleichwertigkeitsideologien und ihren hegemonialen Auswirkungen, um Formen der Identitätsbildung sowie symbolische Konflikte um Status, Anerkennung und Teilhabe nachzuvollziehen.
Das AP gliedert sich in zwei Module.
Modul 1 fokussiert die Perspektive marginalisierter Teilgruppen auf „Allies“ in der Dominanzgesellschaft. Es beinhaltet eine theoretische und empirische Untersuchung des Konzepts „Allyship“ im Kontext von LGBTIQ-Communities. Hierzu werden charakteristische, distinguierende Merkmale von Allyship und ihre Widersprüchlichkeiten aus der Wahrnehmung marginalisierter Gruppen herausgearbeitet. Welche Bedingungen stellen sie an ihre Allies aus der Dominanzgesellschaft? Was sind wirksame Formen von Allyship im Sinne der Stärkung marginalisierter Communities? Allyship wird in ihrer Funktion als Quelle für Akzeptanz gegenüber marginalisierten Perspektiven untersucht. Die durch Allyship (re-)konstruierten Identitäten und Zuschreibungen werden bezüglich der Reproduktion hegemonialer Strukturen und gesellschaftlicher Ungleichheit beleuchtet, um so auch für den Zusammenhalt destruktive Formen von Allyship zu thematisieren.
In Modul 2 werden Rahmenbedingungen von Allyship zwischen marginalisierten Gruppen untersucht. Unter Einbezug der Forschung zu Intersektionalität wird nach potenziellen Allianzen im Sinne eines „rebellischen Universalismus“ gefragt. Wie beziehen sich Emanzipationsbewegungen aufeinander? Inwieweit bieten sie selbst Raum für diverse Perspektiven und entgegnen intersektionalen Diskriminierungserfahrungen? Allyship in der gelebten Engagement-Praxis wird dabei mit den in Modul 1 herausgearbeiteten Gelingensfaktoren und Herausforderungen kontrastiert. Die Bedeutung der eigenen Heterogenität kollektiver Sinnstrukturen, welche auch innerhalb gesellschaftlicher Teilgruppen fortwährend Zugehörigkeiten und Ausschlüsse produzieren, wird mit Blick auf konkrete kollektive Handlungskontexte analysiert. In Kooperation mit Praxispartner:innen werden Handlungsempfehlungen u.a. für Zivilgesellschaft und Politik abgeleitet.